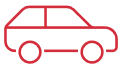THG-Quote: Reform verzögert sich – Was das für Prämien, Markt und Klima bedeutet
- 2025-07-01

Reform der THG-Quote kommt zu spät – mit Folgen für THG-Prämien und Klima
Was hat die EU-Richtlinie RED III damit zu tun?
Was viele nicht wissen: Die THG-Quote ist keine reine deutsche Erfindung, sondern sie geht auf Vorgaben der Europäischen Union zurück. Die EU hat im Rahmen ihrer Klimapolitik die sogenannte RED III beschlossen: Das ist die dritte Version der „Renewable Energy Directive“, also der Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien. In der RED III ist genau geregelt, welchen Anteil erneuerbarer Energien jeder Mitgliedstaat in verschiedenen Sektoren, zum Beispiel Verkehr, erreichen muss. Deutschland muss diese RED III in nationales Recht umsetzen.
Hier ist genau das Problem verankert: Die Umsetzung ins deutsche Recht verzögert sich immer wieder. Dabei wäre der Handlungsbedarf längst offensichtlich. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Betrugsfälle und massive Marktverzerrungen, weil klare gesetzliche Vorgaben fehlten oder zu ungenau waren. Eine echte Reform ist deshalb überfällig, nicht nur um den Vorgaben aus Brüssel gerecht zu werden, sondern ebenfalls, um das System robuster, glaubwürdiger und fälschungssicher zu gestalten.
Reform auf den letzten Drücker – zu spät für den Markt
Aktuell liegt nur ein erster Entwurf für eine Gesetzesänderung vor, obwohl die RED III auf EU-Ebene bereits beschlossen wurde und Deutschland sie eigentlich bis spätestens 2025 umsetzen müsste. Genauer gesagt: eine Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), in dem die Regeln für die THG-Quote verankert sind. Erst Mitte Juni kam der Entwurf und geplant ist nun, dass das Bundeskabinett im Oktober 2025 darüber entscheidet und der Bundestag ihn am 18. Dezember erstmals diskutiert.
Dabei bringt die RED III eine Vielzahl an politisch sensiblen und kontrovers diskutiertem Zündstoff mit sich: von der automatischen Quotenanpassung über die Einschränkung von Mehrfachanrechnungen bis hin zum Ausschluss bestimmter Biokraftstoffe (z. B. Sojaöl, Palmölreste) und strengeren Kontrollpflichten wie verpflichtenden Vor-Ort-Audits. Intensive Debatten zwischen Verbänden, Industrie und Politik werden durch diesen Punkt geleitet.
Das wirkt wie politischer Aktionismus auf den letzten Metern und kommt schlicht zu spät. In Deutschland tritt ein Gesetz erst dann in Kraft, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Bis dahin sind noch zahlreiche Stationen zu durchlaufen: zweite und dritte Lesung mit begleitenden Expertenanhörungen, Bundestag, Bundesrat (sofern erforderlich), Bundesregierung und Bundespräsident. Das braucht Zeit und zwar nicht selten deutlich mehr als nur ein paar Wochen. Wenn die erste Lesung also erst kurz vor Weihnachten erfolgt, ist ein Abschluss aller Verfahren noch vor Jahresende kaum realistisch.
Und selbst wenn das theoretisch klappen sollte, gilt: Verwaltung, Marktakteure, Plattformen und technische Systeme brauchen genügend Zeit für die Umstellung, darum wird in der Regel ein Puffer von mehreren Monaten eingeplant und solche Änderungen in der Praxis immer zum 1. Januar eines neuen Jahres eingeführt, nie mittendrin.
Das zeigt auch die historische Erfahrung: Die letzte große BImSchG-Novelle zur THG-Quote wurde im Sommer 2021 verabschiedet, obwohl das Inkrafttreten erst zum 1. Januar 2022 erfolgte. Und auch hier war die Umsetzungszeit für viele Beteiligte schon sehr knapp.
Zwei Jahre Stillstand– mit Folgen für den Markt
Das schafft also ein langes Zeitfenster der Unsicherheit, mit spürbaren Folgen für alle Marktakteure. Für Unternehmen, die im THG-Quotenhandel aktiv sind, bedeutet die Verzögerung vor allem eines: Über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren herrscht Unklarheit darüber, welche Quotenhöhe und Rahmenbedingungen künftig gelten wird. Das erschwert nicht nur die verlässliche Preisbildung, sondern auch die rechtssichere Vertragsgestaltung und die strategische Mengenplanung erheblich.
Wie sich die Quotenpreise entwickeln könnten
Die fortbestehende regulatorische Unklarheit schlägt direkt auf die Bildung des Marktpreises der THG-Quoten aus, also darauf, wie viel Geld z. B. für pro eingesparte Tonne CO₂ gezahlt wird. Aktuell halten sich viele Marktakteure zurück, weil niemand weiß, wie und vor allem wann sich die Regeln verändern. Diese Unsicherheit bremst nicht nur den Handel, sondern auch die Entwicklung stabiler Preiserwartungen und Planungsprozesse.
Kurzfristig kann die zunehmende Gewissheit, dass der gesetzliche Zeitplan nicht mehr eingehalten werden kann, zu sinkenden Preisen führen. Diese Unsicherheit führt zu Zurückhaltung: Anbieter verkaufen vorsorglich frühzeitig, während Käufer abwarten. Gleichzeitig wächst der Druck verschiedener Lobbygruppen, insbesondere aus der Mineralölwirtschaft, die alles daran setzen, eine ambitionierte Umsetzung zu verzögern oder abzuschwächen. Politische Einflussnahme, gezielte Verzögerungstaktiken und nicht zuletzt mögliche Klagen gegen einzelne Regelungsinhalte könnten das Inkrafttreten zusätzlich verzögern, oder im Extremfall vollständig blockieren.
Mittelfristig ist ein deutlicher Preisanstieg durchaus möglich, wenn das Gesetz ambitioniert umgesetzt wird und schließlich in Kraft tritt. Der aktuelle Entwurf enthält mehrere strukturell wirksame Maßnahmen, die den Markt langfristig stabilisieren und die Qualität der eingesetzten Quoten nachhaltig verbessern könnten. Dazu zählen etwa der Wegfall der Mehrfachanrechnung für fortschrittliche Biokraftstoffe sowie die Einführung neuer Mechanismen zur Betrugsprävention.
Schutz vor Spekulationen und Betrug: Automatische Quotenanpassung
Ein besonders zentraler und wichtiger Bestandteil des aktuellen Gesetzesentwurfs ist die Einführung einer automatischen Quotenanpassung. Obwohl dies zunächst eher technisch klingt, hat diese Maßnahme erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Sie soll gezielt verhindern, dass es durch Manipulationen oder spekulative Überhänge zu Marktverzerrungen kommt.
Die Idee dahinter: Wenn in einem bestimmten Jahr zu viele günstige THG-Quoten im Umlauf sind, etwa weil Mineralölkonzerne sich frühzeitig mit Zertifikaten eingedeckt haben oder weil große Mengen fragwürdiger oder betrügerischer Herkunft gehandelt wurden, dann soll das System gegensteuern. Und zwar, indem im übernächsten Jahr die gesetzlichen Quotenziele automatisch angehoben werden. So steigt die Nachfrage wieder an, und der Markt bleibt ausgeglichen.
Warum das wichtig ist
Ohne effektive Kontroll- und Korrekturmechanismen konnten sich die Akteure aus der Mineralölwirtschaft in den vergangenen Jahren mit günstigen Quoten aus zweifelhaften oder sogar betrügerischen Quellen vollsaugen. Diese Zertifikate werden dann in den Folgejahren eingesetzt, um gesetzliche Verpflichtungen mit minimalem Aufwand zu erfüllen, was gravierende Auswirkungen hat: Die Preise im Quotenhandel geraten zunehmend unter Druck, und der Markt verliert seine Funktion als wirksames Anreizsystem für Klimaschutz. Stattdessen entwickelt er sich immer mehr zu einer spekulativen Abrechnungsplattform.
Die geplante automatische Anpassung der Quote soll genau dem entgegenwirken: Sie erlaubt es dem System, flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Dazu zählen politische Entscheidungen, technologische Innovationen oder auftretende Marktverzerrungen. Dadurch wird verhindert, dass das Quotenmodell zu rigide bleibt und seine klimapolitische Effektivität einbüßt.
Noch ist unklar, wie konkret diese Anpassung umgesetzt wird und wie verbindlich sie tatsächlich greift. Klar ist aber: Ohne solche Mechanismen besteht die Gefahr, dass das System anfällig für Marktverzerrungen bleibt und langfristig seine Glaubwürdigkeit verliert.
Fazit: Ein weiteres Jahr des Stillstands?
Der weitere Verlauf der THG-Quotenpreise hängt entscheidend davon ab, wie schnell und entschlossen die Politik jetzt handelt. Wird das Gesetz noch im Jahr 2025 beschlossen, ambitioniert ausgestaltet und rechtlich sauber geregelt, steigen die Chancen auf stabile und verlässliche Quotenpreise und damit auf ein Marktumfeld, das echten Klimaschutz nachhaltig und wirtschaftlich belohnt.
Doch aktuell deutet vieles darauf hin, dass eine wirksame Umsetzung der RED III zum 1. Januar 2026 kaum noch realistisch ist. Sollte es bei einem späten oder gar verwässerten Beschluss bleiben, ist nicht mit einer Trendwende, sondern vielmehr mit einem weiteren Jahr stagnierender Preise zu rechnen, ein Jahr des politischen Zögerns, das den Markt im Unklaren lässt und Investitionen ausbremst.
Wenn das System seine Steuerungswirkung nicht vollständig verlieren soll, braucht es jetzt ein klares politisches Signal. Nicht irgendwann, sondern in den kommenden Wochen. Nur dann lässt sich verhindern, dass 2026 als weiteres verlorenes Jahr in die Geschichte der THG-Quote eingeht.